Was Betreiber jetzt wissen müssen
Die Pflicht zur Gebäudeautomation nach GEG § 71a betrifft seit Anfang 2025 alle großen Nichtwohngebäude mit leistungsstarken Heizungs-, Lüftungs- oder Klimaanlagen. Diese gesetzliche Vorgabe zielt darauf ab, den Energieverbrauch im Gebäudesektor deutlich zu senken, Kosten zu sparen und den Klimaschutz voranzubringen. Betreiber und Eigentümer stehen nun vor der Aufgabe, ein System für die Gebäudeautomation einzuführen, das die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) erfüllt und gleichzeitig einen nachhaltigen, effizienten Gebäudebetrieb ermöglicht.
Für wen gilt die Pflicht zur Gebäudeautomation?
Die Pflicht zur Gebäudeautomation nach GEG § 71a gilt für alle Nichtwohngebäude, in denen die Nennleistung der Heizungsanlagen oder Klimaanlagen – einschließlich kombinierter Heizungs- und Lüftungsanlagen oder kombinierter Klima- und Lüftungsanlagen – 290 Kilowatt übersteigt. Die Leistung ergibt sich aus der Summe aller Nennleistungen der jeweiligen Anlagen. Dabei sind mehrere kleinere Anlagen, die über ein gemeinsames Verteilsystem verbunden sind, zusammen zu rechnen. Bereits drei Heizungsanlagen mit jeweils 150 kW, die gemeinsam arbeiten, überschreiten die Schwelle und lösen die Pflicht zur Gebäudeautomation aus.
Die Regelung betrifft sowohl Bestandsgebäude als auch Neubauten. Für Bestandsgebäude muss die Pflicht zur Gebäudeautomation bis spätestens 31. Dezember 2024 umgesetzt werden, während Neubauten, für die der Bauantrag oder die Bauanzeige ab dem 1. Januar 2024 eingereicht wurde, die Anforderungen bereits ab Baubeginn erfüllen müssen.
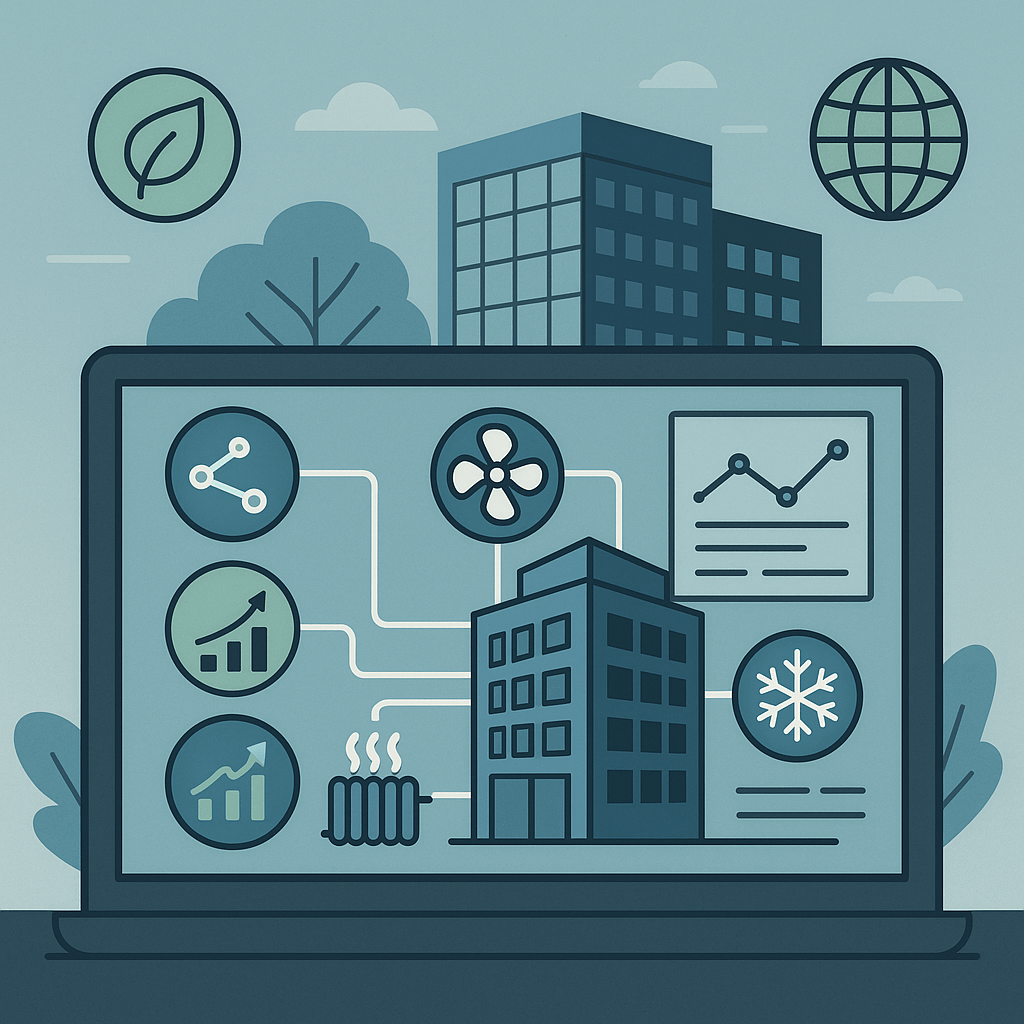
Ziele und Nutzen der Pflicht zur Gebäudeautomation
Die Pflicht zur Gebäudeautomation verfolgt das Ziel, den Energieverbrauch großer Nichtwohngebäude zu senken und die Betriebsführung zu optimieren. Durch die Einführung eines Systems für die Gebäudeautomation gewinnen Betreiber einen umfassenden Überblick über den Zustand und die Energieverbräuche aller gebäudetechnischen Systeme. Die Gebäudeautomation ermöglicht nicht nur ein kontinuierliches Monitoring, sondern auch eine automatische Steuerung und Optimierung der Technik. So lassen sich Einsparpotenziale erkennen und ohne aufwendige Sanierungen realisieren.
Schon bei moderater Umsetzung der Gebäudeautomation – etwa durch den Wechsel von Effizienzklasse C auf B nach DIN EN 15232 – können Sie erfahrungsgemäß mit Einsparungen von rund 20 Prozent bei der thermischen Energie und sieben Prozent bei der elektrischen Energie rechnen. Das Monitoring deckt Schwachstellen auf, sodass Betreiber gezielt Maßnahmen zur Verbesserung ergreifen können und die Energieeffizienz stetig steigt.
Was fordert das GEG konkret für die Gebäudeautomation?
Die Pflicht zur Gebäudeautomation nach GEG § 71a umfasst mehrere technische und organisatorische Anforderungen:
- Kontinuierliches Monitoring: Monitoren Sie alle Hauptenergieträger und gebäudetechnischen Systeme. Das Monitoring umfasst Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, Warmwasserbereitung, eingebaute Beleuchtung, Automation und Steuerung sowie die Stromerzeugung am Standort.
- Frei konfigurierbare Schnittstellen: Das System muss über eine gängige, frei konfigurierbare Schnittstelle verfügen, damit die Daten unabhängig vom Hersteller ausgewertet werden können. So bleibt die Interoperabilität zwischen verschiedenen Systemen und Anwendungen gewährleistet.
- Anforderungswerte und Effizienzüberwachung: Betreiber müssen Anforderungswerte für die Energieeffizienz festlegen. Das System erkennt Effizienzverluste und informiert die verantwortliche Person über Optimierungsmöglichkeiten.
- Benennung einer verantwortlichen Person: Für das Gebäude-Energiemanagement muss eine zuständige Person bestimmt werden, die die Daten auswertet, Potenziale identifiziert und Maßnahmen zur Effizienzsteigerung umsetzt.
Unterschiede zwischen Bestandsgebäuden und Neubauten
Bestandsgebäude
Für Bestandsgebäude steht die Einführung eines Systems im Vordergrund, das Monitoring, Steuerung und Optimierung der Technik ermöglicht. Die Pflicht zur Gebäudeautomation verlangt, dass alle relevanten Daten erfasst und analysiert werden, um Schwachstellen zu erkennen und gezielt zu beheben. Die Interoperabilität spielt auch im Bestand eine zentrale Rolle, denn bestehende Systeme müssen miteinander kommunizieren können, unabhängig vom Hersteller.
Neubauten
Im Neubau gelten strengere Anforderungen: Hier muss die Gebäudeautomation mindestens den Automatisierungsgrad B nach DIN V 18599-11:2018-09 erreichen. Das bedeutet, dass die Systeme nicht nur Daten erfassen, sondern auch aktiv steuern und optimieren. Für die Wärmeerzeugung ist beispielsweise eine witterungsgeführte Regelung mit Raumtemperaturaufschaltung oder eine bedarfsgeführte Regelung mit Kommunikation vorgeschrieben.
Zusätzlich fordert das Gesetz ein technisches Inbetriebnahmemanagement: Die Anlagen müssen während mindestens einer Heiz- beziehungsweise Kühlperiode fachgerecht eingeregelt werden, damit sie optimal laufen und alle Einstellungen aufeinander abgestimmt sind.
Interoperabilität als Schlüsselanforderung
Ein zentrales Element der Pflicht zur Gebäudeautomation nach GEG § 71a ist die Interoperabilität. Alle gebäudetechnischen Systeme und Anwendungen müssen über eine frei konfigurierbare Schnittstelle miteinander kommunizieren können. Diese Anforderung verhindert Insellösungen und stellt sicher, dass Betreiber flexibel auf neue Anforderungen reagieren und verschiedene Systeme kombinieren können. Die offene Architektur fördert Innovation und Wettbewerb, weil niemand an einen bestimmten Hersteller gebunden bleibt.
Konsequenzen bei Verstößen gegen die Pflicht zur Gebäudeautomation
Wer die Pflicht zur Gebäudeautomation nach GEG § 71a vorsätzlich oder leichtfertig nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig umsetzt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Das Gesetz sieht in diesem Fall eine Geldbuße von bis zu 5.000 Euro vor. Die kurze Umsetzungsfrist für Bestandsgebäude sorgt dafür, dass Betreiber schnell handeln müssen, um Sanktionen zu vermeiden.
Zukunftsausblick
Die Pflicht zur Gebäudeautomation nach GEG § 71a setzt europäische Vorgaben der Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) um. In den kommenden Jahren wird der Gesetzgeber die Regelungen voraussichtlich weiter verschärfen und auf zusätzliche Gebäudetypen ausweiten. Wer seine Gebäude jetzt mit moderner Gebäudeautomation ausstattet, ist für künftige Anforderungen gut vorbereitet und kann flexibel auf neue gesetzliche Vorgaben reagieren.
Chance für Effizienz
Die Pflicht zur Gebäudeautomation nach GEG § 71a markiert einen Wendepunkt im Gebäudesektor. Sie fordert von Betreibern und Eigentümern großer Nichtwohngebäude, in digitale Systeme zu investieren, die den Energieverbrauch transparent machen, die Technik automatisch steuern und kontinuierlich optimieren. Das Monitoring deckt Schwachstellen auf, die Interoperabilität sorgt für Flexibilität und Zukunftssicherheit. Wer die Pflicht zur Gebäudeautomation ernst nimmt und umsetzt, profitiert von niedrigeren Betriebskosten, einer besseren Umweltbilanz und einer höheren Attraktivität der Immobilie.
Gerne stellen wir Ihnen den Beauftragten für Gebäudeenergieeffizienz und beraten Sie zu einer kostengünstigen Umsetzung der Richtlinie.
